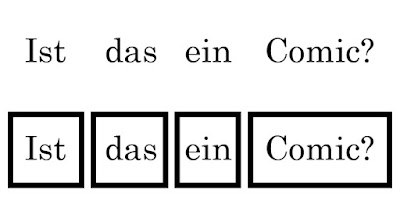Palmen wehen im Wind. 35 Grad. Alcúdia, Mallorca. Die Straßenlaternen sind bereits angegangen, aber das Himmelblau ist noch nicht ganz von der Nacht verschluckt worden. Ich halte die Hand meines Vaters in der Menschenmenge. Alles ist so groß. Ich kann kaum Schritt halten. Wir sind auf dem Weg zum Hotel. Läden ziehen an uns vorbei, Kleiderberge türmen sich vor uns auf. Wir werden zur Seite gedrängt, laufen langsamer weiter. Doch die Hand meines Vaters hat sich gelöst.
Ich schaue nach links. Meine Familie ist verschwunden. Ich schaue mich um. Nichts von ihnen zu sehen. Mein Herz rast. Die Straßen sind überfüllt. Weiß ich überhaupt, wo sich unser Hotel befindet? Ich bin doch bisher immer nur meinem Vater gefolgt. Was soll ich jetzt tun? Ich drehe mich erneut um und renne den Weg zurück. Mit fünf Jahren erlebe ich zum ersten Mal ein bewusstes Gefühl von Hilflosigkeit.
Ängste sind ein fester Bestandteil des Lebens, ein Unwohlsein, eine Unsicherheit, unser unnachgiebiger Antagonist. Als Kinder personifizieren wir sie, geben ihnen feste Formen, um etwas gegen sie unternehmen zu können. Als Erwachsene wissen wir, dass Ängste noch sehr viel perfider sein können, denn sie konfrontieren uns mit unseren Schwächen. Sie sind unsichtbare Monster. Sie nutzen ihre Zeit im Unterbewusstsein, wenn wir abwesend sind und mit unserem Alltag zu tun haben. Und sie nutzen ihre Zeit gut.
Aus einer kleinen Ungenauigkeit folgt der Zweifel an den eigenen Fähigkeiten. Aus einem winzigen Knick im Handeln unserer Liebsten erlangen wir Zuversicht über ihre Gefühle uns gegenüber. Sie wollen uns verlassen. Bestimmt. Wie könnten sie uns auch jemals wirklich gemocht haben? Sie spielen uns doch die ganze Zeit schon etwas vor, oder nicht? Als Erwachsene spüren wir, dass etwas nicht stimmt, aber wir vernachlässigen, uns diesem Zustand zu stellen.
Aus diesem Grund möchte ich mich mit Ängsten beschäftigen, die uns alle betreffen. Und ich möchte versuchen, sie klar zu benennen, damit wir uns gegen sie erheben und sie überwinden können. Zwar können wir sie niemals vollständig besiegen, aber wir können uns bewusst machen, dass sie nur einen kleinen Teil unseres Lebens ausmachen. Und dieses Bewusstsein ist unglaublich viel wert.
Keine Zurückhaltung mehr: Die Angst davor, von anderen allein gelassen, nicht eingeladen, nicht beachtet, nicht verstanden, nicht gemocht zu werden. Es ist ein Freitagabend, wir sitzen in unseren Zimmern, stöbern gerade durch das Internet und vertreiben unsere Zeit mit Bildern auf 9GAG. Es ist ein guter Abend. Doch plötzlich schauen wir auf die Zeit, es ist 21:04 Uhr, und es fangen die Fragen an: Was machen eigentlich meine Freunde? Warum sitze ich hier nur herum? Sollte ich nicht draußen sein und Spaß haben? Warum bin ich allein?
Wir rufen unsere Freunde an. Es klingelt, aber niemand geht ran. Besetzt. Uns erreicht eine Nachricht. Tut mir leid, heute Abend geht nichts. Alles klar. Nächster: Bin total geschafft. Nächster: Bin gerade nicht in der Stadt. Blah, blah, blah. Uns beschleicht das Gefühl, dass das alles nicht richtig ist. Was passiert hier? Warum hat niemand Lust, etwas mit uns zu unternehmen? Waren die Leute ehrlich zu uns, oder haben wir Schuld?
Wir denken nicht darüber nach, dass Menschen zu unterschiedlichen Zeiten, bestimmte Gefühle haben. Wenn wir uns einsam fühlen, dann müssen sich doch all unsere Freunde und unser Partner zur selben Zeit auch einsam fühlen! Und wenn sie sich nicht einsam fühlen, dann stimmt anscheinend etwas mit uns nicht. Sie fühlen nichts mehr für uns. Das ist die einzige mögliche Erklärung, oder nicht?
Nein. Angst vor dem sozialen Ausschluss, vor dem Nichtgehörtwerden, vor dem Alleinsein ist nichts Besonderes. Und es ist auch nichts, was unbedingt von anderen Menschen ausgeht. Natürlich kann es sein, dass man ausgeschlossen wird und natürlich kann es sein, dass man seine Zeit häufig allein verbringt. Aber es liegt an uns selbst, diesen Zustand als etwas Besonderes wahrzunehmen. Wir bestimmen darüber, mit wem wir zu tun haben. Wir bestimmen darüber, was wir tun wollen.
Und wenn wir ehrlich sind, dann brauchen wir häufig auch diese Zeit nur für uns, wo keiner dumme Sprüche macht, wo wir im Bett liegen und lesen, ohne dass jemand uns ständig fragt, ob wir Lust haben, heute Party zu machen. Wir genießen diese Zeit. Wir kommen von Arbeit, schauen eine Serie oder ein Let's Play, um runter zu kommen. Wir sind die meiste Zeit nicht allein, weil wir ausgeschlossen werden. Wir sind die meiste Zeit allein, weil wir es als zu anstrengend empfinden, ständig mit Menschen zusammen zu sein, die andere Vorstellungen davon haben, wie das Leben funktioniert.
Und wenn uns bewusst wird, dass das nicht nur uns betrifft, dann haben wir vielleicht weniger Schwierigkeiten damit, mit unserer Einsamkeit umzugehen. Es ist 21:44 Uhr. Wenn heute schon nichts mehr geht, dann können wir ja wenigstens an dem einen Projekt arbeiten, das wir schon seit Ewigkeiten aufgeschoben haben. Das ist gut für unser Selbstbewusstsein und wir schaffen endlich das, was wir uns vornehmen.
Wir rufen unsere Freunde an. Es klingelt, aber niemand geht ran. Besetzt. Uns erreicht eine Nachricht. Tut mir leid, heute Abend geht nichts. Alles klar. Nächster: Bin total geschafft. Nächster: Bin gerade nicht in der Stadt. Blah, blah, blah. Uns beschleicht das Gefühl, dass das alles nicht richtig ist. Was passiert hier? Warum hat niemand Lust, etwas mit uns zu unternehmen? Waren die Leute ehrlich zu uns, oder haben wir Schuld?
Wir denken nicht darüber nach, dass Menschen zu unterschiedlichen Zeiten, bestimmte Gefühle haben. Wenn wir uns einsam fühlen, dann müssen sich doch all unsere Freunde und unser Partner zur selben Zeit auch einsam fühlen! Und wenn sie sich nicht einsam fühlen, dann stimmt anscheinend etwas mit uns nicht. Sie fühlen nichts mehr für uns. Das ist die einzige mögliche Erklärung, oder nicht?
Nein. Angst vor dem sozialen Ausschluss, vor dem Nichtgehörtwerden, vor dem Alleinsein ist nichts Besonderes. Und es ist auch nichts, was unbedingt von anderen Menschen ausgeht. Natürlich kann es sein, dass man ausgeschlossen wird und natürlich kann es sein, dass man seine Zeit häufig allein verbringt. Aber es liegt an uns selbst, diesen Zustand als etwas Besonderes wahrzunehmen. Wir bestimmen darüber, mit wem wir zu tun haben. Wir bestimmen darüber, was wir tun wollen.
Und wenn wir ehrlich sind, dann brauchen wir häufig auch diese Zeit nur für uns, wo keiner dumme Sprüche macht, wo wir im Bett liegen und lesen, ohne dass jemand uns ständig fragt, ob wir Lust haben, heute Party zu machen. Wir genießen diese Zeit. Wir kommen von Arbeit, schauen eine Serie oder ein Let's Play, um runter zu kommen. Wir sind die meiste Zeit nicht allein, weil wir ausgeschlossen werden. Wir sind die meiste Zeit allein, weil wir es als zu anstrengend empfinden, ständig mit Menschen zusammen zu sein, die andere Vorstellungen davon haben, wie das Leben funktioniert.
Und wenn uns bewusst wird, dass das nicht nur uns betrifft, dann haben wir vielleicht weniger Schwierigkeiten damit, mit unserer Einsamkeit umzugehen. Es ist 21:44 Uhr. Wenn heute schon nichts mehr geht, dann können wir ja wenigstens an dem einen Projekt arbeiten, das wir schon seit Ewigkeiten aufgeschoben haben. Das ist gut für unser Selbstbewusstsein und wir schaffen endlich das, was wir uns vornehmen.
Zwei Stunden später. Wir haben nichts gemacht. Und wir sind im nächsten Tief: Die Angst davor, etwas nicht zu schaffen, was man sich vorgenommen hat, etwas nie schaffen zu können, andere zu enttäuschen, sich selbst zu enttäuschen, nichts verändern zu können, nichts erreichen zu können. Das Studium sollte uns erst einmal eine Basis geben, weiter darüber nachzudenken, was wir eigentlich mit unserem Leben anstellen wollen. Nachdem es die Schule phänomenal vergeigt hat, uns eine klare Vorstellung davon zu geben, wohin wir mit unseren Ideen gehen sollen, schien das Studium der nächstbeste Anlaufpunkt.
Doch jetzt sind wir im fünften Semester. Eigentlich haben wir nichts wirklich gelernt, außer dass wir ein paar neue Namen kennengelernt haben, die wir uns gegenseitig an den Kopf werfen können. Aber nun gut. Das Studium ist ja nur der Zwang, damit wir herausfinden, was wir eigentlich wollen. Unsere eigentliche Leidenschaft liegt in unseren Hobbys. Wir komponieren Musik, drehen Filme, schreiben seit Ewigkeiten an unserem ersten Roman, entwickeln diese eine App, die das Leben aller Smartphone-Besitzer für immer verändern wird. Das Übliche.
Aber selbst nach zwei Jahren ist immer noch nichts so weit, dass wir es anderen zeigen möchten. Wir sind geschafft. Eigentlich müsste doch mindestens ein kleines Bisschen vorhanden sein, das unsere Motivation retten kann? Doch nach den zwei Stunden wird uns klar, dass wir eigentlich immer noch zu wenig wissen. Wir wissen, was Kunst ist, und das, was wir da abliefern, das ist es nicht.
Wir haben das Gefühl, dass wir unsere Zeit verschwendet haben, dass wir eigentlich zu Größerem berufen waren, aber irgendwann den Einsatz verpasst haben. Wir hätten uns viel intensiver mit den Ideen beschäftigen sollen, viel mehr üben und experimentieren müssen. Aber zum Schluss haben wir zu wenig getan. Und jetzt sitzen wir hier und denken darüber nach, was wir eigentlich noch mit unserem Leben anfangen wollen, nachdem wir alles weggeworfen haben, wofür wir in unserer Jugend gekämpft haben.
Oder spielt das absolut keine Rolle? Es ist vollkommen egal, wie häufig wir scheitern oder wie häufig wir etwas hinbekommen, denn wir werden niemals wirklich zufrieden sein, solange wir uns mit dem Zählen beschäftigen. Menschen lernen über direktes Versagen, indem sie ihr Verhalten anpassen und dadurch die Ergebnisse verbessern. Menschen hören nicht einfach damit auf, wenn es nicht funktioniert, denn es gibt keine Alternative zum Glücklichsein.
Lasst uns das Gefühl begraben, dass wir etwas erreichen müssen und geben wir uns der Tätigkeit für sich hin. Lasst uns Ziele setzen, bei denen wir uns nicht selbst enttäuschen können! Wir müssen etwas nicht schnell fertig bekommen. Wir müssen am Ende einfach nur damit zufrieden sein. Wir müssen niemandem beweisen, was wir können. Wir sind niemandem Rechenschaft schuldig.
03:14 Uhr. Wir erwachen aus einem unruhigen Schlaf. Bilder aus unserer Vergangenheit kommen uns in den Sinn. Der Regen prescht gegen die Fenster. Die Schatten wechseln an der Wand. Wir können glücklich sein. Wir können allein sein. Doch letztendlich beunruhigt uns etwas, das sich lange versteckt gehalten hat. Unser Stress hat uns davor bewahrt, uns intensiver damit zu beschäftigen. Freunde und Arbeit haben sie verborgen: Die Angst davor, dass trotz allem, trotz all der Schönheit auf dieser Welt, alles egal ist. Die Angst davor, dass wir alle sterben werden.
Doch jetzt sind wir im fünften Semester. Eigentlich haben wir nichts wirklich gelernt, außer dass wir ein paar neue Namen kennengelernt haben, die wir uns gegenseitig an den Kopf werfen können. Aber nun gut. Das Studium ist ja nur der Zwang, damit wir herausfinden, was wir eigentlich wollen. Unsere eigentliche Leidenschaft liegt in unseren Hobbys. Wir komponieren Musik, drehen Filme, schreiben seit Ewigkeiten an unserem ersten Roman, entwickeln diese eine App, die das Leben aller Smartphone-Besitzer für immer verändern wird. Das Übliche.
Aber selbst nach zwei Jahren ist immer noch nichts so weit, dass wir es anderen zeigen möchten. Wir sind geschafft. Eigentlich müsste doch mindestens ein kleines Bisschen vorhanden sein, das unsere Motivation retten kann? Doch nach den zwei Stunden wird uns klar, dass wir eigentlich immer noch zu wenig wissen. Wir wissen, was Kunst ist, und das, was wir da abliefern, das ist es nicht.
Wir haben das Gefühl, dass wir unsere Zeit verschwendet haben, dass wir eigentlich zu Größerem berufen waren, aber irgendwann den Einsatz verpasst haben. Wir hätten uns viel intensiver mit den Ideen beschäftigen sollen, viel mehr üben und experimentieren müssen. Aber zum Schluss haben wir zu wenig getan. Und jetzt sitzen wir hier und denken darüber nach, was wir eigentlich noch mit unserem Leben anfangen wollen, nachdem wir alles weggeworfen haben, wofür wir in unserer Jugend gekämpft haben.
Oder spielt das absolut keine Rolle? Es ist vollkommen egal, wie häufig wir scheitern oder wie häufig wir etwas hinbekommen, denn wir werden niemals wirklich zufrieden sein, solange wir uns mit dem Zählen beschäftigen. Menschen lernen über direktes Versagen, indem sie ihr Verhalten anpassen und dadurch die Ergebnisse verbessern. Menschen hören nicht einfach damit auf, wenn es nicht funktioniert, denn es gibt keine Alternative zum Glücklichsein.
Lasst uns das Gefühl begraben, dass wir etwas erreichen müssen und geben wir uns der Tätigkeit für sich hin. Lasst uns Ziele setzen, bei denen wir uns nicht selbst enttäuschen können! Wir müssen etwas nicht schnell fertig bekommen. Wir müssen am Ende einfach nur damit zufrieden sein. Wir müssen niemandem beweisen, was wir können. Wir sind niemandem Rechenschaft schuldig.
03:14 Uhr. Wir erwachen aus einem unruhigen Schlaf. Bilder aus unserer Vergangenheit kommen uns in den Sinn. Der Regen prescht gegen die Fenster. Die Schatten wechseln an der Wand. Wir können glücklich sein. Wir können allein sein. Doch letztendlich beunruhigt uns etwas, das sich lange versteckt gehalten hat. Unser Stress hat uns davor bewahrt, uns intensiver damit zu beschäftigen. Freunde und Arbeit haben sie verborgen: Die Angst davor, dass trotz allem, trotz all der Schönheit auf dieser Welt, alles egal ist. Die Angst davor, dass wir alle sterben werden.
Wem machen wir etwas vor? Wir wissen alle, dass es keine Bestimmung für uns gibt. Es sind schöne Geschichten, die wir uns selbst erzählen, wenn wir davon ausgehen, dass es unsere Aufgabe ist, dies oder das zu erreichen. Aber selbst wenn wir es erreicht haben, was kommt danach? All unsere Anstrengungen im Leben, all unsere Bedürfnisse, jegliche Liebe, wofür? Warum stehen wir jeden Morgen auf? Was unterscheidet ein glückliches Leben von einem unglücklichen?
Wir sind doch nichts weiter als Sklaven einer Natur, die uns vorspielt, dass Glück ein wertvolles und erreichbares Gut ist. Doch hinter wie vielen Fassaden steckt die Unzufriedenheit, der Mangel und die daraus entstandene Wut? Welche Menschen kennen wir denn, die wirklich glücklich sind, die wirklich mit dem zufrieden sind, was sie haben? Und selbst wenn, steckt dahinter nicht immer noch nur eine Illusion, die diese Menschen daran hindert, eben den wahren boshaften Kern des Lebens zu erkennen: dass es eben nichts Böses gibt und nichts Gutes, dass alles, wenn wir nur den Zeitraum groß genug ansetzen, vollkommen belanglos wird? Wir sterben doch sowieso irgendwann und es ist vorbei. Warum den Tod hinauszögern? Warum Angst vor dem Tod und Angst vor der Sinnlosigkeit des Lebens haben? Das ist doch paradox.
Ich renne durch die Menschenmenge und suche meine Familie. Suchen sie mich nicht? Mir kommt es so vor, als wäre ich schon Stunden unterwegs. Ich bleibe stehen, Tränen fließen meine Wangen hinunter. Ich verliere mich in immer fantasievolleren Ängsten. Wie konnte das nur passieren? Ich bin doch auch nur ein Mensch.
Doch plötzlich sehe ich meinen Vater. Er stürmt durch die Menge. Ich renne los und nach wenigen Sekunden sind wir wieder zusammen. Wir waren nur wenige Augenblicke voneinander getrennt, aber es war so ein unfassbares Gefühl der Wärme, ihn wieder in den Arm nehmen zu können, sein Herz zu hören. Wenn wir Angst haben, begrenzen wir unsere Wahrnehmung auf die Dinge, die uns verletzen können und blenden die Dinge aus, die weiterhin um uns herum passieren. Dieser Moment mit meinen Eltern, diese Umarmung, war alles für mich, so wie zuvor die Angst alles für mich gewesen ist. Lasst uns also versuchen, die Umarmungen willkommen zu heißen und die Ängste beiseite zu legen!